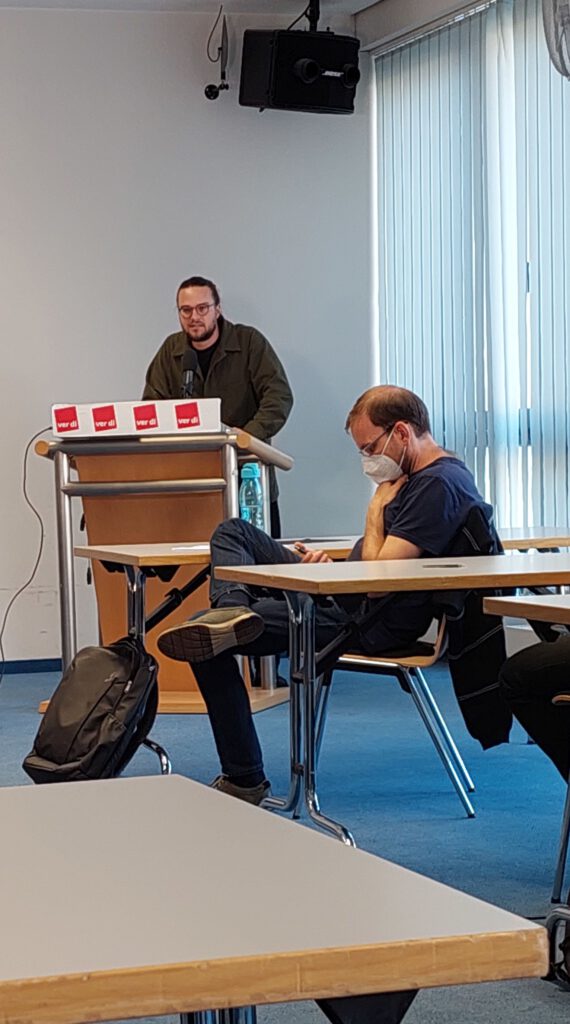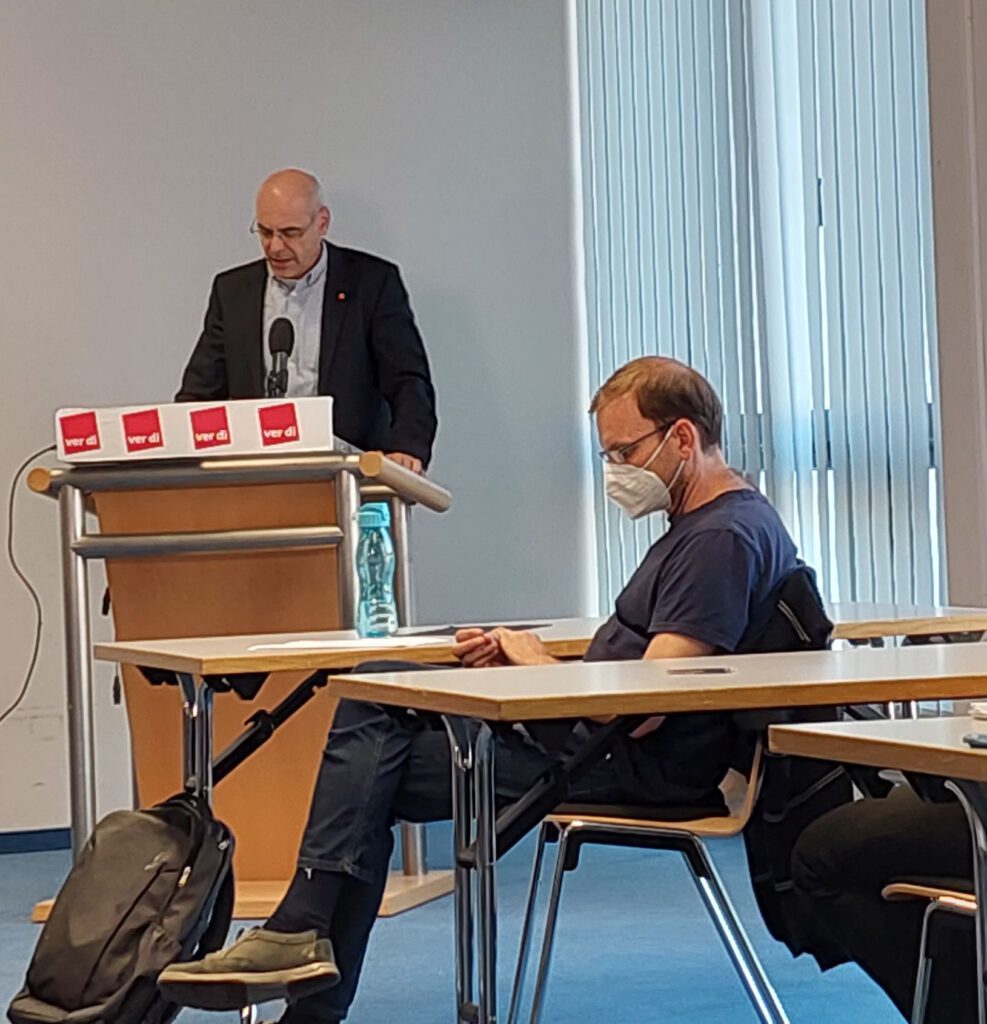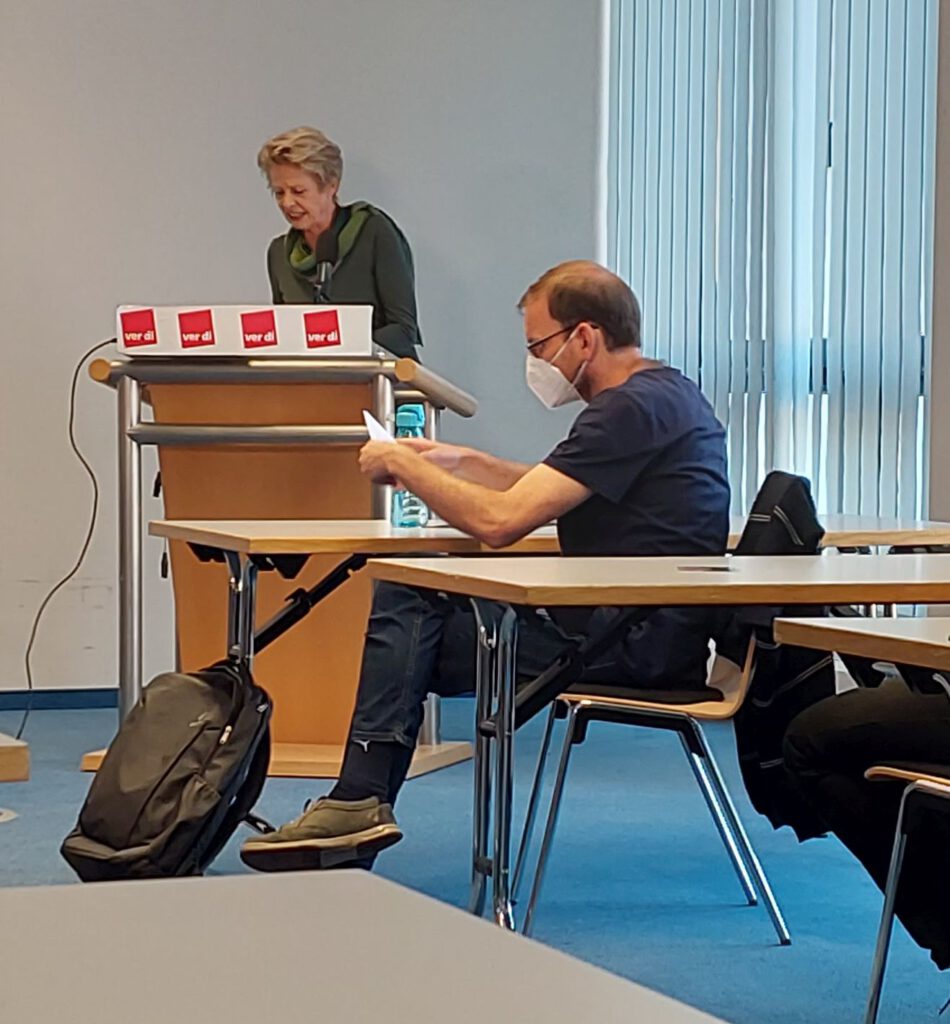Dieser Text erschien zuerst bei der Wochenzeitung ›Der Freitag‹ (13.03.2020) unter freitag.de.
Gesundheit Huch, hatten wir in den Klinken nicht gerade noch „Überkapazitäten“? Wie die Corona-Krise den Irrsinn von Fallpauschalen und Erlösorientierung offen legt.
Die Coronavirus-Epidemie macht deutlich, dass Krankenhäuser eine gesellschaftliche Infrastruktur sind, die für Krisenfälle eine ausreichende Kapazität vorhalten muss.
Zeitgleich zur Verbreitung des Corona-Virus entbrennt eine Diskussion darüber, ob das deutsche Gesundheitssystem für einen solchen Krisenfall gewappnet ist. Erste Signale, dass es hier nicht zum Besten steht, hat die Regierung selbst unfreiwillig gesendet: Bereits vergangene Woche erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die erst kürzlich in Kraft getretenen minimalistischen (Pflege-) Personalvorgaben („Untergrenzen“) für die Krankenhäuser vorerst wieder außer Kraft zu setzen, damit die Krankenhäuser auch dann unter Volllast behandeln können, wenn das (Pflege-) Personal knapp wird. In dieser Hinsicht wirkt die Cornona-Pandemie eher wie ein Brennglas, in dem schon länger bekannte Probleme besonders scharf sichtbar werden: es fehlt an Personal in den deutschen Krankenhäuser.
Die Pandemie sorgt jedoch auch in weiteren krankenhauspolitischen Fragen für eine Perspektivverschiebung. Von (neo)liberaler Seite wurden in den vergangenen Jahren vor allem die angeblichen „Überkapazitäten“ an Bettenplätzen und Krankenhausstandorten in Deutschland in den Mittelpunkt der Debatte gestellt. Sie würden zu einer Fehlsteuerung der Ressourcen führen. Weniger Betten konzentriert an weniger Krankenhausstandorten – so die über Jahre eingeübte Kernbotschaft – würden ermöglichen, mit dem vorhandenen Personal die Pflegebedingungen für PatientInnen und Beschäftigte zu verbessern und sogar noch Geld zu sparen. Die im europäischen Vergleich hohe Bettendichte pro EinwohnerIn gilt in dieser Argumentation als Beleg für Rationalisierungspotential.
Die Debatte verschiebt sich
Mit der Corona-Pandemie verschiebt sich die Debatte. Jens Spahn wird in diesen Tagen nicht müde zu betonen, dass Deutschland mit seiner im europäischen Vergleich hohen Dichte insbesondere von Intensivbetten, gut auf Corona vorbereitet sei und über „ein vergleichsweise gut bis sehr gut ausgestattetes Gesundheitssystem“ verfüge. Was gestern also noch eines der größten Probleme des deutschen Krankenhauswesens gewesen sein soll, verwandelt sich von einem auf den anderen Tag in ein wichtiges Argument für die ,Leistungsfähigkeit des Deutschen Gesundheitswesens‘. Dass der Minister es für nötig hält, die Personalvorgaben für diese Bereiche außer Kraft zu setzen, verweist jedoch darauf, dass man auch im Gesundheitsministerium nicht restlos von der eigenen Botschaft überzeugt ist.
Diese Entwicklung macht deutlich, dass Krankenhäuser eine gesellschaftliche Infrastruktur sind, die für Krisenfälle eine ausreichende Kapazität vorhalten muss. Diese Kapazitäten können per Definitionem im nicht-Krisenmodus zumindest zum Teil nicht genutzt werden.
Damit sind wir beim Kern der deutschen Krankenhausmisere: der Finanzierung nach den sog. Fallpauschalen (DRG). Denn deutsche Krankenhäuser bekommen nur ein Minimum ihres Budgets für die Vorhaltung von Kapazitäten. Die Krankenhäuser werden pro Patientenfall bezahlt, den sie behandeln. Sie müssen ihre Kapazitäten immer so auslasten, dass sie über die Erlöse durch die einzelnen Patientenfälle genug Geld einnehmen, um den Betrieb ihrer gesamten Infrastruktur (inklusive Personal) finanzieren zu können.
Was Lauterbach verschweigt
In einem solchen System handelt betriebswirtschaftlich unverantwortlich, wer seine Kapazitäten nicht so weit wie möglich auslastet. Für den Krisenfall vorgehaltene (leere) Betten sind aus der individuellen Krankenhausperspektive Erlösausfälle. Das Problem beginnt also nicht erst – wie man es aktuell in verschiedenen Stellungnahmen hört – mit der Gewinnorientierung. Es beginnt bereits mit der „Erlösorientierung“ – also dem Zwang den gesamten Betrieb durch das Erbringen von „Leistungen“ finanzieren zu müssen – unabhängig davon, ob diese individuell oder gesellschaftlich gerade sinnvoll sind. Es wäre, wie wenn die Feuerwehr nur für jeden gelöschten Brand bezahlt werden würde.
Dies gilt auch für die aktuelle Situation. Aus epidemiologischer Sicht müssten die Krankenhäuser schon jetzt beginnen, Kapazitäten frei zu machen, indem planbare – sog. elektive – Eingriffe verschoben werden. Dies soll nun nach Absprache zwischen Bund und Ländern ab Montag umgesetzt werden. Für das Krankenhaus ist das jedoch ein betriebswirtschaftliches Risiko, für das es im aktuellen Finanzierungssystem keine Lösung gibt. Denn zum einen wissen die Krankenhäuser nicht, wann und in welchem Umfang die Corona-Fälle wirklich kommen und sie entsprechend mit ihnen Geld verdienen können. Noch wichtiger: sie wissen auch nicht ob die Erlösausfälle, die sie vielleicht durch die Verschiebung von lukrativen „Fällen“ erleiden, durch die Erlöse über Corona-PatientInnen kompensiert werden können. Zumal diese wegen der Notwendigkeit der Isolation viele Kapazitäten in Beschlag nehmen werden. Das schwant inzwischen auch dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der in der Tagesschau davor warnte, dass private Klinikbetreiber sich gegen die Aufnahme von Corona-PatientInnen wehren könnten, weil sie damit „lukrativere“ Patienten verlieren. Was Lauterbach verschweigt: durch das Fallpauschalen-System, das er seinerzeit selbst mit eingeführt hat, besteht dieser Anreiz auch für öffentliche und freigemeinnützige Häuser.
Durch die Art der Krankenhausfinanzierung stehen die betriebswirtschaftlichen Einzelinteressen der Krankenhäuser also in einem beständigen Spannungsverhältnis zum öffentlichen Interessen an einer Gesundheitsinfrastruktur. Dies wird in der aktuellen Situation zu beständigen Verzögerungen und Problemen in den Abstimmungsprozessen führen. Krankenkassen und Krankenhäuser sollen sich nach Willen des Gesundheitsministeriums nun darüber verständigen, wie Erlösausfälle kompensiert werden sollen. Angesichts der Tatsache, dass diese beiden Akteure sich jedes Jahr mit tausenden von Gerichtsverfahren, wegen Abrechnungsfragen überziehen, werden sie sich nicht leicht tun, sich über die nicht ganz banale Frage zu verständigen, wie diese Erlösausfälle zu berechnen sind. Die Bundesregierung zieht sich hier aus der Affäre, in einer Situation, in der jede Unsicherheit vermieden werden muss.
Ohne Desinfektion
Bis zu der jüngst angekündigten Absage der planbaren Behandlungen wurde das Problem vor allem durch das Aussetzen der „Untergrenzen“ auf dem Rücken der Beschäftigten gelöst. Wie reibungslos diese Ankündigung angesichts des Erlösdrucks umgesetzt wird, werden die nächsten Tage zeigen. Der Pflegeberufsverband DBfK berichtet bereits davon, dass Kliniken das Aussetzen der Untergrenzen nutzen um Betten mit Nicht-Corona-PatientInnen zu belegen. Dabei ist das Aussetzen der Personalstandards bei der Ausbreitung eines hoch ansteckenden Virus besonders widersinnig. Eine der zentralen Gegenmaßnahmen gegen die Übertragung im Krankenhaus, ist eine ausgiebige Händedesinfektion. Umfragen unter Pflegekräften habe gezeigt, das diese bei Unterbesetzung mit als erstes vernachlässigt wird.
Wir lernen also jetzt schon aus der Krise, dass die Propagierung angeblicher Überkapazitäten und der Notwendigkeit von flächendeckenden Krankenhausschließungen, wie sie die Bertelsmann-Stiftung und andere betreiben, unverantwortlich ist. Es ist aber darüber hinaus überfällig, Alternativen zum bestehenden System der Fallpauschalen-Finanzierung zu entwickeln. Krankenhausversorgung darf nicht den Marktanreizen überlassen, sondern muss demokratisch geplant werden.
Kalle Kunkel hat als Verdi-Gewerkschaftssekretär die Streiks zu Personalbemessung an der Charité in Berlin mitorganisiert. Er ist in der Kampagne „Krankenhaus statt Fabrik“ aktiv.